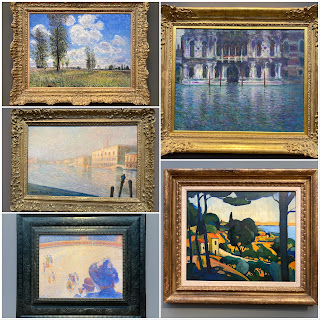Von Freitag bis heute früh war ich auf einem Eselshof in Rheinland-Pfalz in der Nähe der Loreley. Ich bin mit dem Zug über Frankfurt (Main) nach St. Goarshausen gefahren und wurde dort abgeholt. Der Ort Bornich wurde vermutlich schon vor rund 2.800 Jahren besiedelt (Bronzezeit). Mit der Eroberung der rechtsrheinischen Gebiete durch die Römer hinterließen auch sie ihre Spuren hier, z.B. durch Straßen oder auch Terrassen an den Hängen des Forstbachtal, in dem ich war. Der Forstbach mündet bei der Burg Katz in den Rhein. Ich arbeitete auf einem Hof, der Großesel züchtet. Den Hof, „
Odins Mühle“, habe ich über
WWOOF gefunden. Die Züchterin und der Züchter verfolgen seit 30 Jahren das Ziel hier gesunde Großesel (über 130 cm Stockmaß) artgerecht aufzuziehen. Es gibt „kuschelige“ Poitou-Esel, katalanische Großesel und Weiße Barockesel, ein paar Maultiere und eine Kaltblutstute mit Fohlen (2 Monate). Es gibt Hunde, Hühner und im Tal laufen auch noch zwei Pfaue herum. Die Esel werden pädagogisch-therapeutisch und in der Landschaftspflege eingesetzt, als Zug- und Lasttiere oder für den touristischen Einsatz ausgebildet. Der Betrieb beteiligt sich an Naturschutzmaßnahmen: Umwandlung von Ackerflächen in Grünland, Blühstreifen, Insektenhotel, Fledermauskästen, Nistkästen etc. Gäste können auf dem Gelände gleich ein
Ferienhaus buchen und täglich die sehr freundlichen und kommunikativen Tiere erleben.

Die tägliche Morgenroutine auf dem Hof beginnt bei den Hühnern: Stall öffnen, füttern, Wasser nachschütten, eine Extraportion für eine alte Glucke. Dann geht es weiter mit den jeweiligen Futtermischungen (Hafer oder Schrot) plus Fallobst zu den Eseln und Maultieren, drei einzeln stehenden Hengsten, der Kaltblutstute mit ihrem Fohlen Adele und dann zu den Galloways. Ein Galloway-Bulle steht mit Kühen und Kälbern zusammen. Dort ist Trinkwasser aus dem Wassertank nachzufüllen. Eine Gruppe Färsen, also junge Kühe, die noch nicht geboren haben, steht getrennt, bei ihnen einer der Hengste, auch dort eventuell Wasser nachfüllen. Mit dem Kaltblutfohlen wird ab und zu Halftertragen und am-Strick-geführt-werden trainiert. Nebenbei gehen die beiden Hunde „Gassi“ und finden so allerlei, z.B. Mäuse. Die zweite Eselsherde, eine Stutenherde u.a. mit Poitou-Zwillingen (knapp 5 Monate alt, sowas gibt es echt selten) wird danach noch umgekoppelt. Es ist faszinierend, wie wiederholte Rufe „Esel komm!“ aus dem vorbeifahrenden Auto und ein Eimer Äpfel zur Verstärkung ausreichen, die Herde über 250 m Distanz in Bewegung zu setzten. Die „Morgenroutine“ dauert alles in Allem etwa 1 1/2 Stunden. Am Abend wird ein Hengst und die Stutenherde wieder umgekoppelt und ein Teil der Hühner wieder eingesperrt, die anderen schlafen draußen auf einem Baum.

Tagsüber standen dann alltägliche Hofarbeiten an: Am Samstag und Montag haben wir eine neue Weidefläche umzäunt. Die Stutenherde kam am Dienstag erstmalig drauf. Der „Umkoppeln“ war wirklich ein „Spaziergang“ im Vergleich zu solch einer Aktion mit Pferden. Kein Esel trägt Halfter, sie kommen mit ein bisschen Unterstützung durch Rufe und vielleicht ein paar Äpfeln einfach mit.
Dann waren noch Himbeeren zu ernten, im Garten etwas Unkraut zu jäten, die Heuraufe bei den Rindern zu reinigen, auf der neuen Koppel Leinkrautsamen zu „ernten“, um deren Vermehrung auf der Fläche zu reduzieren und Holz für die Gäste bereitzustellen. Es sind eben viele Dinge im Blick zu behalten. Das gelang mir mal besser, mal schlechter. Es war eine gute Zeit für mich und ich konnte neue Dinge lernen über die Landwirtschaft, die Esel und auch über mich.
Der Umgang mit den Eseln war sehr entspannt und viel unkomplizierter, als ich es mit Pferden gewohnt bin. Esel sind kommunikativ, sie interessieren sich, sind in neuen Situationen nicht auf Flucht eingestellt, wie Pferde oder auch die Maultiere auf dem Hof. Das macht den Umgang sehr angenehm.
Ein bisschen touristisches Programm machte ich auch noch: Am Sonntag spazierte ich ein Stündchen zur Loreley (4 km), dem berühmten 132 m hohen Felsen an der Rheinkurve bei St. Goarshausen. Ich kannte die Gegend bisher nur aus dem Blickwinkel von „unten"- vom Rhein - hoch zu den Bergen und Burgen. Es ist interessant zu sehen, dass die Landschaft hier „oben" nur leicht wellig mit ein paar Kuppen ist, sich die Flüsse und Bäche jedoch sehr tief eingeschnitten haben, nicht nur der Rhein, sondern auch der kleine Forstbach von der Tür. An der Loreley hat man natürlich einen sehr schönen Blick ins Rheintal. Es gibt ein
Besucherzentrum, eine Sommerrodelbahn und ein Gartenlokal.

Heute habe ich den Eselshof verlassen und bin weiter nach Rüdesheim gefahren, das waren gut 25 Minuten mit dem Zug. Ich spazierte etwas durch den Ort, der bekannt wurde mit Asbach-Uralt, Rüdesheimer Kaffee und der „Drosselgasse “. Später fuhr ich mit einer Seilbahn hoch zum Niederwalddenkmal mit einer pompösen der Germania. Der Anlass zur Erbauung des Niederwalddenkmals war der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 und die anschließende Gründung des Deutschen Kaiserreiches am 18. Januar 1871. Das Denkmal wurde jedoch erst am 28.September 1883 nach zwölf Jahren Planung und Bau eingeweiht. Es besteht neben der monumentalen Germania noch aus patriotischem Heldentext, zwei Alegorien „Krieg“ und „Frieden“ sowie einem Relief mit 133 Personen in Lebensgröße, darunter Wilhelm I zu Pferde umgeben von Generälen und Fürsten aus Nord- und Süddeutschland und fünf der sechs Strophen des Liedes „Die Wacht am Rhein“. Das Niederwalddenkmal reiht sich ein in die Liste der monumentalen Gedenkstätten des Kaiserreichs, wie dem Deutschen Eck in Koblenz, dem „Hermann“ bei Detmold, dem Kaiser- Wilhelm- Denkmal an der Porta Westfalica, dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, dem Bismarck-Denkmal in Hamburg, dem Barbarossadenkmal auf dem Kyffhäuserberg und der Walhalla bei Donaustauf.

In Rüdesheim waren nachmittags die Touristen Ü70 unterwegs, abends Ü40 bis um 60. Ich dachte, dass ich gar nicht wissen will, was hier „ohne Corona“ los wäre. Es lagen fünf Kreuzfahrtschiffe vor Anker, zu denen die älteren Reisenden gegen 18 Uhr wieder zurückströmten. Die Kapazität jedes einzelnen Schiffes liegt so zwischen gut 100 bis knapp 200 Passagieren. Die Reisenden kommen aus Deutschland, Schweiz, Niederlande und Skandinavien. Die Läden und Hotels machen auf mich den Eindruck, in den 1970/80ern stehen geblieben zu sein: Mahagoniefurnier und Messinggriffe schmücken auch mein Zimmer im Hotel
Felsenkeller, das war nach den Fotos noch die bessere Wahl. Direkt an den Rheinanlegern finden sich Wein- und Asbach-Läden, sehr große Souvenirshops mit Motivgläschen und Fachwerkhäusern aus Plastik, ein paar Restaurants. Es werden billiger Schmuck, billige Taschen, einfache Hüte/Mützen, Pullover aus Synthetikfasern, praktische (Angler-)Westen, Jacken, Schuhe und natürlich - als erste Neuerung seit 30 Jahren - auch Masken angeboten, für 24,95€ auch mit Foto von Rüdesheim. In der berühmten
Drosselgasse gibt es auf 144 Metern 5 oder 6 Restaurants, ein, zwei Wein- und ein paar Souvenirläden. Ich ging abends Wildfleisch-Burger essen, „aus eigener Jagd“. Das scheint mir auch eine jüngere Entwicklung zu sein. War lecker.
🇨🇭 Einen Rückblick in die Schweiz: Mit gut 61% wurde am 27.09. die Volksinitiative der rechtspopulistischen Partei SVP abgelehnt, die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union aufzukündigen. Der bezahlte zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub soll kommen (Zustimmung 60,3%) und das neue Jagdgesetz, das den Abschuss von Wölfen erleichtern sollte, wurde mit 51,9 Prozent abgelehnt. Das Budget für neue Kampfflieger steht bereit.